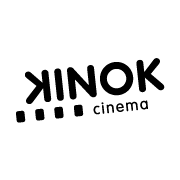American Voodoo
In memorian David Lynch
von Florian Keller
Das Licht flackert, es knistert in der Leitung. Funken sprühen, ein Mann verliert buchstäblich den Kopf. Welcher Film von David Lynch ist das? Mehrere Antworten sind richtig.
Ob er Albträume habe? Es war meine einzige Begegnung mit David Lynch, in einer Hotelsuite in Berlin, zusammen mit einem halben Dutzend weiteren Journalist:innen aus ganz Europa. Round Tables nennt man solche Gruppeninterviews in der Branche, sie sind eine Plage, aber mit Lynch an diesem runden Tisch fühlte es sich an wie eine Séance. Albträume also? «Nein!» erwiderte er sehr bestimmt. Überhaupt, so fuhr er in seiner unvergleichlich schnarrenden Stimme fort, hole er die Ideen für seine Filme fast nie aus Träumen. Und dann wurde er wieder sehr bestimmt: «Alles in meinen Filmen ist logisch, logisch, logisch.»
Wie hat er das gemeint? Und spielt es überhaupt eine Rolle, wie Lynch das gemeint haben könnte? Es ist wie mit seinen Filmen: Nur weil wir uns so schnell keinen Reim darauf machen können, müssen wir nicht gleich den Kopf verlieren.
Wobei diese Filme zunächst ja gar nicht so komplizierte Schlaufen drehen. Da ist «Eraserhead» (1977), dieser verstörende Psychotrip über die Überforderung eines Mannes angesichts des hilflosen kleinen Monsters, das man ihm als Frühgeburt seiner Freundin anhängt. Gefolgt von «The Elephant Man» (1980), einem für Lynchs Begriffe geradezu klassischen Drama über Ausgrenzung und Schaulust, das ihm – sicher auch dank humanistischer Botschaft – nicht weniger als acht Oscarnominierungen einbrachte. Und später dann «Blue Velvet» (1986) und «Wild at Heart» (1990), wo Lynch, immer noch ziemlich geradlinig, mit Versatzstücken des amerikanischen Genrekinos operiert: das obszöne Begehren in den trügerischen Kulissen von Suburbia, die unsterbliche Liebe auf den gesetzlosen Strassen des Westens.
«Do you like mysteries that much?» So fragt die treuherzige Sandy (Laura Dern) in «Blue Velvet», als sie mit dem jungen Hobbydetektiv (Kyle MacLachlan) im Auto sitzt. Liebst du Geheimnisse so sehr? Er darauf nur: «Yeah.» Sie wisse gar nicht recht, sagt Sandy auch, ob er nun ein Ermittler sei oder ein Perversling. (Logisch, logisch, logisch, dass er beides ist.)
Die Motive von Sex und Crime variiert Lynch dann weiter im Fernsehen mit «Twin Peaks» und im nachgeschobenen Kinofilm «Twin Peaks: Fire Walk with Me» (1992). Doch die epochale TV-Serie markiert zugleich auch die Schwelle zu seinem verrätselten Spätwerk, in dem Lynch seine Ideen mit jedem Film immer freier drehen lässt, ins Surreale, ins Metaphysische. Man kann das in einem aufschlussreichen Selbstversuch nachvollziehen, angefangen bei «Lost Highway» (1997). Wer aus diesem Film nicht so recht schlau wird und sich zwischen den verschiedenen Ebenen verliert, wird ihn rückblickend gar nicht mehr so verwirrend finden, sobald man einmal «Mulholland Drive» (2001) gesehen hat; und wer dann aus diesem Film nicht so recht schlau wird und sich zwischen den verschiedenen Ebenen verliert, wird wiederum «Mulholland Drive» rückblickend gar nicht mehr so verwirrend finden, sobald man einmal «Inland Empire» (2006) gesehen hat.
Ausgenommen natürlich der Film, den wir in der Abfolge unterschlagen haben, weil er diesen Selbstversuch hintertreiben würde: «The Straight Story» (1999), dieses Tempo-30-Roadmovie über einen alten Mann auf grosser Ausfahrt und der einzige von Lynchs Filmen, zu dem er das Drehbuch nicht selber geschrieben hat. Auch nicht verwunderlich: In der Schweiz, dem Land der Traktoren, war ausgerechnet dieser untypischste aller Filme von David Lynch auch mit Abstand sein erfolgreichster.
Abgesehen von «The Straight Story» schraubt sich der Lynch-Kosmos seit «Twin Peaks» mit jedem Film immer tiefer ins Spiritistische: American Voodoo. Das trägt dem späten Lynch auch den Ruf ein, seine Filme seien undurchsichtig, unergründlich, unverständlich. Doch wer die vor sich hin wuchernden Mysterien bei Lynch als solipsistische Spleens eines bekennenden Esoterikers abwerten will, ist selber schuld. Denn, und das ist entscheidend: von diesen Filmen geht nie etwas Missionarisches oder Sektiererisches aus. Und auch wenn Lynchs Kino sich als überaus anschlussfähig erwiesen hat für theoretische, insbesondere auch psychoanalytische Zugänge: Das sind keine Filme nur für Eingeweihte. Was daran vielleicht hermetisch wirkt, sollte man vielmehr als radikale Offenheit sehen.
Vielleicht der irreführendste Begriff, der auch nach Lynchs Tod wieder gerne bemüht wurde für seine Filme: abgründig. Ein Abgrund ist etwas Bodenloses, aber die Böden, die bleiben bei Lynch eigentlich ziemlich stabil – auch wenn dort Insekten schmatzen, wie in der berühmten Eröffnungssequenz in «Blue Velvet», die den obszönen Appetit des Gangsters Frank Booth (Dennis Hopper) vorwegnimmt. Die stimmigere Metapher für Lynchs Filme bleibt deshalb das Möbiusband: Die Ebenen nahtlos ineinander verdreht, nie könnte man sagen, auf welcher Wahrnehmungsschlaufe man sich gerade befindet, weil ein Traum jederzeit in die Wirklichkeit kippen kann und umgekehrt. Zumal bei Lynch immer auch gilt: Wer meint, aus einem Traum aufzuwachen, ist vielleicht gar nicht richtig wach, sondern findet sich bloss in einer weiteren Traumblase wieder.
Keine Abgründe also. Wenn schon, lauert das Grauen bei Lynch in der Horizontalen, auf Augenhöhe. In den feinsten Abstufungen der Schwärze in «Lost Highway», in dieser modernistischen Betonvilla des Jazzmusikers, wo der Korridor in raumloser Finsternis sich zu verlaufen scheint; oder hinter den roten Vorhängen in «Twin Peaks», von denen wir nie wissen können, was sich dahinter verbirgt, und wenn es nur ein Nichts wäre; oder auch, am helllichten Tag, hinter dem Diner am Anfang von «Mulholland Drive» (2001), wo ein Mann von einem Angstgesicht erzählt, von dem er wiederholt geträumt hat, und dann taucht dieses dort wirklich wie geträumt aus dem Hinterhalt auf, als wär’s der sprichwörtliche Butzemann.
In «Mulholland Drive» findet sich auch eine der schönsten Vignetten überhaupt über die Macht der Fiktion und den Zauber der Illusionsmaschine Kino. Und wo spielt die Szene? Wo sonst als auf einer dieser Nachtclub- und Varietébühnen, die schon seit «Eraserhead» zur Grundausstattung im Lynch-Universum gehören, und wo sonst als wieder vor einem seiner roten Vorhänge. «No hay banda!» ruft der Conférencier im «Club Silencio» in den Saal: Lasst euch nicht täuschen, da ist keine Band, die Musik spielt hier nur ab Konserve. Doch als nun Rebekah Del Rio auftritt und zu ihrem «Llorando» anhebt, sich dabei die Seele aus dem Leib singt, da fliessen auf den Rängen gleichwohl die Tränen – bis die Sängerin auf offener Bühne plötzlich kollabiert und ihre Stimme, aus den genannten Gründen, trotzdem weitersingt, während ihr lebloser Körper weggetragen wird, hinter den Vorhang.
Im ausformulierten Beschwörungszauber dieser Szene offenbart sich auch ein künstlerisches Credo, das fast alle Filme von David Lynch auf die eine oder andere Weise prägt: maximale Affekte bei maximaler Künstlichkeit, nicht obwohl, sondern weil die Illusion von Anfang an als solche deklariert wird.
Was übrigens die oft behauptete Unverständlichkeit von Lynchs Filmen betrifft, hat Dietmar Dath in seinem Nachruf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung alles dazu gesagt. Mit dieser sogenannten Unverständlichkeit bei Lynch, so Dath, sei ja eigentlich nur ihre «Nichtnacherzählbarkeit» gemeint: «Wer unter ‹verstehen› versteht, dass man etwas aus Bild, Ton und Bewegung Gemachtes in Text übersetzt, geht hier leer aus.» Mit anderen Worten: Wer sich darauf einlässt, was Lynch aus Bild, Ton und Bewegung macht, kann sich bei ihm endlos verlieren. (Allein Lynchs elaborierte Sounddesigns hätten eine eigene Abhandlung verdient.) Und wer partout auf so etwas wie Inhalt und Geschichten fixiert bleibt, ist im Kino, dem Reich von Licht und Dunkel, vielleicht sowieso am falschen Ort.
Noch eine letzte Frage aus jener Séance damals mit Lynch in Berlin: Ob er, wo «Inland Empire» doch fast ausschliesslich auf Laura Dern fokussiert sei, diesen Film auch mit einer anderen Schauspielerin hätte drehen können? Das, erwiderte David Lynch, sei ein Spiel, das man, einmal damit angefangen, endlos weitertreiben könne: «Hätte ich ‹Inland Empire› mit einem Cast drehen können, das ausschliesslich aus Hunden besteht? Ich würde mir das vielleicht überlegen und allmählich verrückt werden dabei.»
Florian Keller (*1976 in Winterthur) ist Kulturredaktor bei der «WOZ – Die Wochenzeitung». Davor schrieb er lange für den «Tages-Anzeiger«, zuerst als freier Kritiker und später während acht Jahren als Filmredaktor. Er hat Anglistik und Germanistik an der Universität Zürich studiert und unterrichtet gelegentlich an der Zürcher Hochschule der Künste.
 Heute
Heute