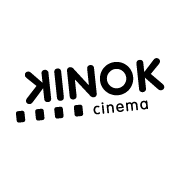Die Zwiebelfrau
Zum widerspenstigen Werk der Schauspielerin Rooney Mara
von Alexandra Seitz
Es gibt ja diese Binsenweisheit «harte Schale, weicher Kern», mit der umschrieben wird, dass eine:r sich unnahbar, gar abweisend gibt, tatsächlich aber ein grosses Herz hat und viel Gefühl. Nun könnte man versucht sein zu sagen, dass im Fall der Schauspielerin Rooney Mara der Fall eher umgekehrt liegt, «weiche Schale, harter Kern» nämlich: die nach Aussen hin zart und verletzlich wirkende, kleine und zierliche, mädchenhafte Frau, in der unvermutete Zähigkeit, Mut und Stärke stecken. Man hätte zwar recht, würde dann aber eine in Maras Karriere bedeutsame Figur wie Lisbeth Salander, «the Girl with the Dragon Tattoo», unter den Tisch fallen lassen, in deren harter Schale ein noch viel härterer Kern steckt, in dem wiederum die Ahnung von etwas Weichem allenfalls kurz aufblitzt. Aufblitzt als etwas, das die Figur in sich verbirgt, weil sie sich darüber im Klaren ist, dass es sie angreifbar macht. Denn Weichheit und Schwäche fallen in einer Frau des Öfteren in eins, und wenn eine die Kunst der Tarnung nicht beizeiten lernt und stattdessen beharrt auf ihrem So-Sein, dann geht sie ein Risiko ein. Salander ist nicht die einzige Figur in Maras Filmografie, die davon Zeugnis ablegt, und nicht nur sie erscheint undurchsichtig und unergründlich, tatsächlich bodenlos; Mara beherrscht diese Kunst, die Kunst, Schichten zu spielen.
Geboren wird Patricia Rooney Mara am 17. April 1985 in Bedford, New York, wo sie auch aufwächst. Sie ist das dritte von vier Kindern einer Familie, die väter- wie mütterlicherseits tief in Geschichte und Geschäft des American Football verwurzelt ist. Nachdem sie die High School in Bedford absolviert hat, beginnt sie ein Studium an der New York University; dort sammelt sie in filmischen Arbeiten ihrer Kommilitoninnen erste Erfahrungen mit der Schauspielerei. Im Gegensatz zu ihrer zwei Jahre älteren Schwester Kate Mara (vielen bekannt als Zoe Barnes in der Fernsehserie «House of Cards»), die bereits mit neun Jahren im Schultheater ihrem Berufswunsch begegnet, kommt Rooney Mara also erst relativ spät auf den Geschmack. An der Seite von Schwester Kate hat sie 2005 ihren ersten Auftritt als «Classroom Girl #1» in dem Direct-to-Video-Slasherhorror «Urban Legends: Bloody Mary». Es folgen kleine Rollen in kleinen Filmen und Auftritte in TV-Produktionen, bis sie schliesslich 2009 in dem Indie-Film «Tanner Hall», einem Coming-of-Age-Ensembledrama, eine der Hauptrollen übernimmt. Im Jahr darauf hat sie ihre erste grössere Rolle in einem Mainstreamfilm inne, die der Nancy in dem vielbeachteten Remake des Slasherklassikers «A Nightmare on Elm Street» – das allerdings glorios floppt. Ganz im Gegensatz zu dem zweiten Film, der 2010 in die Kinos kommt und in dem Mara, wenngleich in einer Nebenrolle, mitspielt: «The Social Network» von David Fincher, einer der Hits des Jahres. In seinem nächsten Projekt «The Girl with the Dragon Tattoo» betraut Fincher Mara dann mit der zentralen Rolle von Computer-Wizard Lisbeth Salander – eine Besetzungsentscheidung, die von den Fans der Millennium-Trilogie des schwedischen Schriftstellers Stieg Larsson ebenso kritisch-gespannt verfolgt wurde wie seinerzeit jene über die Hobbits in «The Lord of the Rings». Rooney Mara schlägt ein wie das Geschoss, das sie auf der Leinwand verkörpert, und erhält ihre ersten Oscar- sowie Golden-Globe-Nominierungen (die zweiten folgen 2016 für ihre Darstellung in Todd Haynes’ «Carol»). Danach ist es vorbei mit allfälliger leichtgewichtiger Unterhaltungsware. 2013 lernt Mara bei den Dreharbeiten zu Spike Jonzes «Her» Joaquin Phoenix kennen, mit dem sie später noch in «Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot» (Gus Van Sant, 2018) und «Mary Magdalene» (Garth Davis, 2018) zusammenarbeiten wird. Seit 2016 sind die beiden ein Paar und leben mit ihren mittlerweile zwei Kindern in den Hollywood Hills.
Wie ihr Gefährte begreift auch Mara den Beruf der Schauspielerei nicht als Mittel zu Reichtum, Ruhm und Egomanie. Sie arbeitet vielmehr an einem in sich Bedeutung tragenden Figurenensemble. Aus ihren Kollaborationen mit erfolgreichen Autorenfilmern wie David Fincher, Steven Soderbergh, David Lowery und anderen setzt sich ein Kaleidoskop von Frauenbildern zusammen; diese thematisieren die Zurichtung, Einschränkung und Unterdrückung des weiblichen Geschlechts und legen zugleich die Machtstrukturen und Manipulationsmechanismen des Patriarchats offen.
Bevorzugt bewegt sich Mara dabei an den Rändern, widmet sich Aussenseiterinnen und Ausgegrenzten, Verspotteten, Verbotenen und Verteufelten. Auf Lisbeth Salander, die sich wie der Fuchs in der Falle eher ein Bein abreissen würde, als passiv auf den Todesstoss zu warten, folgt etwas später mit Emily Taylor in Soderberghs «Side Effects» (2013) ein weiterer schwer zu durchschauender Charakter zwischen Opfer und Täterin: Ist Emily hetero, depressiv und wird zur Leidtragenden einer Medikamentenstudie sowie der Machenschaften ihres geltungssüchtigen Psychiaters? Oder ist sie lesbisch, manipulativ und fällt letztlich in die Grube, die sie anderen gegraben hat? Fest steht nur, dass es ein Mann war, der ihr den Boden unter den Füssen entzogen hat, und dass Improvisation im freien Fall riskant ist. Die Psychiatrie als einer der Orte, an dem weibliches Fehlverhalten bevorzugt sanktioniert wird, liefert einen der zentralen Schauplätze von Jim Sheridans «The Secret Scripture» (2016), in dem am Beispiel einer jahrzehntelang widerrechtlich hospitalisierten Frau kritisch über die rigide Sexualmoral der irischen Kirche reflektiert wird. Um lesbische Liebe wiederum kreist Haynes’ «Carol» (2015). In der Verfilmung des 1952 unter Pseudonym erschienenen, autobiografisch inspirierten Romans The Price of Salt von Patricia Highsmith spielt Mara an der Seite von Cate Blanchett eine Schockverliebte, die gegen die Konventionen ihrer Zeit Stimme und Weg findet. Männer spielen hier lediglich Nebenrollen, halten aber die Fäden in der Hand. Ebenso wie in dem stark reduzierten «Women Talking» von Sarah Polley (2022), in dem die Frauen einer abgeschiedenen Mennoniten-Kolonie darüber debattieren, wie sie mit der gewohnheitsmässigen Betäubung und Vergewaltigung durch die männlichen Gemeindemitglieder umgehen sollen – im Übrigen ein wahrer Fall. Gleichermassen reduziert und kontroversiell: «Una» (2016), Benedict Andrews’ Adaption des 2005 uraufgeführten Theaterstücks «Blackbird» von David Harrower. Die (inzwischen erwachsene) Titelheldin konfrontiert ihren ehemaligen Nachbarn, mit dem sie als Dreizehnjährige Geschlechtsverkehr hatte. Ein klarer Fall von Missbrauch, der, motiviert von Lolita-Komplex und Pädophilie, verursacht durch Selbstüberforderung und Unterschätzen des Gegenübers, dann doch nicht so einfach liegt. Erforscht wird in «Una» ein emotionales Geflecht, das sich aufspannt zwischen dem Mädchen, das sich seiner verführerischen Ausstrahlung und damit sexuellen Macht bewusst wird, und dem nur scheinbar domestizierten, nicht mehr jungen Mann, in dem sich mit einem Male wieder der Raubtier-Macho regt. Ausgelotet werden die komplexen Untiefen einer damit in Relation gesetzten Schuldfrage, und zunehmend wird deutlich, dass ihr mit einem schlichten, binären «Ja oder Nein», «Täter oder Opfer» nicht beizukommen ist.
Die Geschlechterverhältnisse sind kompliziert – auch das ist eine Binse – und die Rollenbilder hinken der Gegenwart hinterher. Ohne die bedingungslos Liebende kommen unsere Filmträume weiterhin nicht aus. Also unterzieht Mara, deren engelhafte Physis sie als geradezu prädestiniert für Darstellungen des Romantischen erscheinen lässt, auch diese Gestalt der Überarbeitung. Als Beispiele mögen «Ain’t Them Bodies Saints» (2013) und «A Ghost Story» (2017) dienen, Maras Kollaborationen mit David Lowery an der Seite von Casey Affleck. Ein sanftes Drama um Verbrechen und Strafe und eine rätselhafte Geistergeschichte, zentriert jeweils um die Wucht der Emotion: An die Stelle der Propagandabegriffe Liebe und Leidenschaft treten Zärtlichkeit und Zugehörigkeitsgefühl. Rooney Mara ist keine Frau der Vereinfachung, sie ist eine der Wahrhaftigkeit.
Alexandra Seitz ist freie Filmkritikerin und lebt in Berlin.
 Heute
Heute