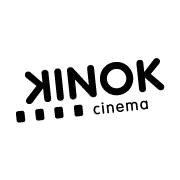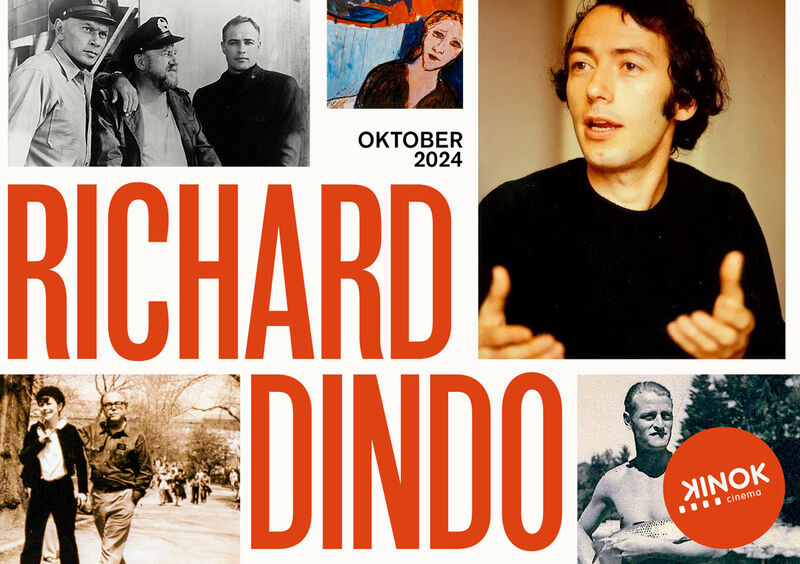
Auf der Suche nach der verborgenen Fiktion
Die frühen Filme von Richard Dindo
von Walter Ruggle
Wahrscheinlich habe ich 1973 den Filmemacher Richard Dindo allein schon deshalb erstmals wahrgenommen, weil er an den Solothurner Filmtagen «Naive Maler in der Ostschweiz» präsentierte und ich meine familiären Wurzeln in der Ostschweiz habe. Wahrnehmung ist ja immer auch von persönlicher Erfahrung gelenkt. In jenen Jahren lief im Vorprogramm der Kinos noch die Wochenschau, in der man Aktualitäten zusammengefasst als Wahrheit präsentiert bekam. Dokumentierende Filme waren bewegte Bilder, die mit allwissender Kommentarstimme unterlegt wurden. Das, was man als «Neuen Schweizer Film» bezeichnen würde, hatte eben erst begonnen. Es gab einen Spielfilm aus der Westschweiz («Charles mort ou vif», 1969) und einen Dokumentarfilm aus der Deutschschweiz («Siamo italiani», 1964), die Aufsehen erregt hatten, weil sie das bis dahin Gewohnte nicht pflegen wollten. Filme wie diese befreiten das filmische Erzählen von alten Mustern, schilderten ein Stück Alltag, dem sie andere Wahrheiten entlockten und: Poesie.
Richard Dindo, 1944 in Zürich in eine Arbeiterfamilie mit italienischen Wurzeln hineingeboren, hat sich just in dieser Zeit nach Paris abgesetzt, in jene Stadt, die ihm ein Leben lang zweite Heimat bleiben sollte. An der Seine wurde er doppelt sozialisiert: Auf den Strassen von 1968 erlebte er den Aufstand der Jugend, in der Cinémathèque sog er sich mit Filmgeschichte voll. Zu seinen Lieblingen zählten Autoren wie Rossellini, Welles, Hitchcock oder Godard. In der Cinémathèque habe er begriffen, notiert Dindo heute auf seiner Homepage, was Kino sei, «hauptsächlich bei den französischen und amerikanischen Klassikern, wo es um die Schönheit geht, die Poesie, die Sprache, die Erinnerung, die Fiktion und die Politik. Das heisst, ich habe die Filmgeschichte auch als Geschichtsunterricht verstanden, wo es in letzter Instanz immer wieder um Gerechtigkeit geht, um die Freiheit des Einzelnen und der Völker sowie die Emanzipation der Frau.»
Nach den ersten halb fiktiven, halb dokumentarischen Gehversuchen beschloss er, Dokumentarfilme zu drehen, und sagte sich: «Eigentlich bin ich ja ein naiver Filmemacher, so mache ich einen Film über naive Maler.» Da zeigt sich auch schon ein Wesenszug Richard Dindos: Er liebt die Sprache, und er liebt das Spiel mit ihr. Kino beginnt bei ihm mit dem Wort, der Sprache entlang findet er seine Bilder. Seine Filme, angefangen von «Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.» über «Max Frisch, Journal I–III» zu «Ernesto ‹Che› Guevara, das bolivianische Tagebuch», basieren auf Geschriebenem – Reportage, Erzählung, Tagebuch – und lassen dem Text auch im Film seinen Raum.
Zum literarischen Text gesellt sich bei Richard Dindo der O-Ton der alltäglich gesprochenen Sprache mit der Direktheit der Äusserungen von Menschen, ihren Sprachmelodien. Wir begegnen Weggefährt:innen des St.Gallers Ernst S., hören in «Grüningers Fall», wie Zeitzeug:innen sich an den Polizeihauptmann erinnern, und lauschen der Lehrerin in La Higuera, dem Dorf in Bolivien, wo Che Guevara exekutiert wurde. In den Filmen von Richard Dindo redet nicht der Filmemacher als Allwissender, in seinen Filmen reden die Leute, die er aufsucht. Er ist der Wissbegierige, der die Menschen, denen er auf dem Pfad seiner jeweiligen Geschichte begegnet, erzählen lässt und über die er eine Direktheit und Authentizität schafft, die neu sind, erfrischend und prägend.
So wichtig die gesprochene Sprache für Dindo ist, so gern er geschriebenen Texten folgt, die er als Basis für die Filme verwendet, so sehr teilt er das ihn dabei visuell Inspirierende mit uns. Wie die Texte tastet er auch die Schauplätze ab. Er kann auf dem Bild eines grossstädtischen Schildergewirrs in New York verharren, dem ein literarisches Stück unterlegt ist, oder auf der Zeitzeugin in Bolivien, deren Schilderung er Raum lässt. Die Spannung und die Poesie in seinen dokumentarischen Arbeiten entstehen in diesen Jahren aus der schauenden Lektüre heraus, der «filmischen Lektüre», wie er es im Untertitel zum Frisch-Film bezeichnet hat. Er liest mit Kamera und Mikrofon, montiert selber Gedrehtes mit Fundstücken aus Archiven.
Richard Dindo hat sich in dieser Zeit den Ruf eines politischen Filmemachers geholt, ohne dieses Etikett gesucht zu haben. Im Gegenteil: Er klassiert nicht, was er sieht, er betrachtet, hört und zeigt. Aber das, was er in Bilder fasst und an Stimmen aufzeichnet, will den politisch Verantwortlichen nicht gefallen. Sie wollen die Deutungshoheit über Geschichtliches behalten, und es sollte noch Jahre dauern, bis sie definitiv und auf Druck von aussen nachgeben müssen.
In den 1970er-Jahren wurde Dindos Film über Spanienkämpfer:innen im Fernsehen nicht ausgestrahlt, weil es nicht passte, was den porträtierten Schweizer:innen zum Wort «Heimat» einfiel. Dem «Landesverräter»-Film wurde vom Bundesrat die Qualitätsprämie verweigert, die Dindo von der Jury mit 13:1 Stimmen zuerkannt worden wäre. Zehn Jahre später verweigerte der Zürcher Erziehungsdirektor den von der zuständigen Jury einstimmig beschlossenen Filmpreis für «Dani, Michi, Renato und Max». In diesem Film erzählt Richard Dindo von vier Jugendlichen, die in der Zeit der Jugendunruhen Opfer von polizeilicher Gewalt wurden. Die künstlerischen Qualitäten der Filme wurden nie infrage gestellt, ihr Inhalt passte den Kassenwarten nicht, denn, so verteidigte die NZZ die Haltung der Regierung, eine kulturelle Auszeichnung hätte die politischen Entscheide infrage gestellt.
Eine Wahrheit gibt es nicht, also kann man die Wahrheit nicht filmen. Aber Wahrnehmungen von Geschehenem kann man sich annähern, auch filmisch. Richard Dindo reist auf seinen Spurensuchen an scheinbar unscheinbare Orte, um ihnen ein Stück Geschichte zurückzugeben, er stellt Momente nach und versucht uns eine Ahnung zu geben von dem, was war oder wie es gewesen sein könnte. Um Fragen zu stellen, auch an sich selber. Ein Waldstück, an dem ein junger Mann von Soldatenkollegen exekutiert wurde, weil die offizielle Schweiz an ihm ein Exempel statuieren wollte; die älteste Fischbeiz in New York, in die der Schriftsteller Max Frisch mit der Verlagsangestellten Lynn zum ersten Mal essen ging; ein Gerichtssaal in St.Gallen, in dem Paul Grüninger sass und verurteilt wurde. Wenn Dindo Spuren folgt, Bilder der Landschaften und Orte aufnimmt, so wird unversehens Geschichte lebendig, egal, ob sie gross ist wie bei Che oder klein wie bei Ernst. Es sind Interesse und Neugier, die ihn antreiben, er will genauer hinschauen, hinhören, will besser verstehen.
Max Frisch notierte in seiner Erzählung «Montauk», auf deren Spuren sich Richard Dindo in «Max Frisch, Journal I-III» bewegt: «Leben ist langweilig. Ich mache Erfahrungen nur noch, wenn ich schreibe.» Mir scheint, das ist eine Bemerkung, die der Filmemacher teilen dürfte. Dindo filmt während fünfzig Jahren beinahe atemlos, erfährt Leben also beim Filmen. Erinnerungsarbeit steht auch in seinem Werk im Zentrum – wenn auch indirekt. Dindo redet in seinen Filmen nicht in der ersten Person, seine Figuren tun es. Er sagt, dass er an einem Familienroman arbeite und Sohn oder Bruder seiner Figuren sei. Die Familie ist im Lauf der Jahre gross geworden. Zu seinen Vätern gehört neben Max Frisch auch der Schauspieler und Regisseur Max Haufler, dem Dindo das einfühlsame Denkmal «Max Haufler, ‹Der Stumme›» gesetzt hat. Das ist ein Film, in dem Fiktion und Dokument einander berühren und begleiten. Hier ist es Hauflers Tochter Janet, die in der ersten Person spricht. Der Filmemacher folgt ihr einerseits an Orte ihres Vaters, inszeniert anderseits mit der Schauspielerin Janet Haufler Elemente der Verfilmung von Otto F. Walters Der Stumme, Hauflers letztem und nie realisiertem Projekt. Innere und äussere Wirklichkeit verschränken sich zu einer Erzählung.
Natürlich kann der Textverliebte auch von Bildern ausgehen, wie das bei Charlotte Salomon geschieht, die die Nazis 26-jährig in Auschwitz ermordeten. Im Exil in Frankreich hatte sie ihre Jugend in Berlin in 769 Gouachen festgehalten. Richard Dindo sucht im Film «Charlotte, Leben oder Theater?» in diesen Bildern, ergänzt mit eigenen Spurensicherungen, den Lebensfaden der jungen Frau. Dabei entstand eine ebenso einfache wie sinnliche Variation der Spurensicherung, der Rekonstruktion, des Zeugnisses. Es ist die Malerei, die ihn hier zum Leben führt, eine Malerei mit naiven Anklängen und voller Poesie.
Das Fiktive und Elemente von Fiktivem spielen in Richard Dindos Filmen eine wichtige Rolle. Auf meine Frage, ob er sich am Ende im Dokumentarischen doch wohler gefühlt habe als im Spielfilm, antwortete er vor Jahren: «Ich brauche einfach wahre Geschichten. Ich kann keine Geschichten erfinden. Meine Intelligenz funktioniert von der Realität her. ‹Die Geschichte, die ich erzähle, ist schon da, ich muss sie nur lesen›, sagt Proust. Der Dokumentarfilm ist mein Medium, wobei meine Filme wie Spielfilme funktionieren.» Womit wir an einem wichtigen Punkt von Dindos filmischer Arbeit angelangt wären: Er begibt sich im Realen auf die Spuren, um im Gefundenen das Fiktive zu wecken.
Walter Ruggle ist Filmpublizist und Kinomacher, von 1999 bis 2020 war er Direktor der Stiftung trigon-film.
 Heute
Heute