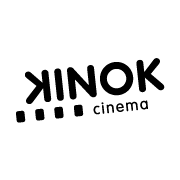Ilo Ilo
Regie: Anthony Chen
Darst.: Yann Yann Yeo, Tian Wen Chen, Angeli Bayani, Jialer Koh, Peter Wee, Jo Kukathas, Naomi Toh, Stephanie Kiong u.a.
Singapur 1997. Ein mittelständisches Ehepaar in dem südostasiatischen Stadtstaat engagiert Teresa, eine junge philippinische Immigrantin, als Hausangestellte und Betreuerin für den zehnjährigen Sohn Jiale. Dieser ist seit dem Tod seines geliebten Grossvaters «schwierig» geworden, reagiert widerspenstig und bockig auf alles. So beginnt für die herzensgute Philippinin, die nur gebrochen Englisch, aber kein Chinesisch – die Sprache ihrer Arbeitgeber – spricht, zunächst ein wahrer Kreuzweg. Während Hwee Leng, Jiales Mutter, die erneut schwanger ist und ganz in ihrer eigenen Welt lebt, Teresa mit unverhohlener Geringschätzung behandelt und der Vater Teck den meisten Konflikten ausweicht, kopiert Jiale das Verhalten der Mutter und zeigt Teresa bei jeder sich bietenden Gelegenheit seine Verachtung: Sie ist ja nur eine «Magd». Doch mit der ausbrechenden Wirtschaftskrise verschärfen sich die ohnehin schwelenden Probleme zwischen den Eheleuten; sie haben noch weniger Zeit für ihren Sohn als zuvor. Dieser ist nun einerseits immer mehr auf sich allein gestellt, doch andererseits wird er sich langsam bewusst, dass er in Teresa eigentlich eine wunderbare Freundin und Komplizin hätte – eine so wunderbare wie berührende Freundschaft beginnt. Mit Ausnahme der Filme von Eric Khoo hat bisher noch nie ein Film aus Singapur den Weg in unsere Kinos gefunden. Doch mit «Ilo Ilo», dessen Titel eine philippinische Stadt bezeichnet und der am Filmfestival Cannes 2013 den Preis für das beste Erstlingswerk gewann, dürfte sich das ändern. «Ein kleiner, leiser Film aus einem wenig bekannten Filmland. (…) Mit einer minimalen Handlung, jedoch wunderbar sprechenden Bildern, die kleine Gesten und Stimmungen einfangen, lässt uns Anthony Chen in einen Alltag eintauchen, der uns sicherlich fremd ist und zugleich wieder vertraut vorkommen muss, denn so gefühlvoll, so präzise wird hier das universell Menschliche inszeniert.» Till Brockmann, NZZ
 Heute
Heute