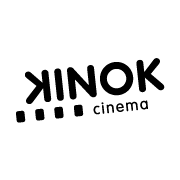Pelo malo
Regie: Mariana Rondón
Darst.: Beto Benites, Samantha Castillo, Samuel Lange Zambrano, Nelly Ramos, María Emilia Sulbarán u.a.
Der neunjährige Junior lebt zusammen mit seinem wenige Monate alten Bruder bei seiner Mutter Marta in einer Plattenbausiedlung in Caracas. Während Marta, die soeben ihren Job als Personenschützerin verloren hat, weiss ist, hat Junior, dessen verstorbener Vater schwarz war, dunkle Haut und krause Haare. Dass dieses «schlechte Haar» (pelo malo) von Nachteil ist, hat der Junge, der einem von ihm verehrten Sänger nacheifert, längst kapiert. Die Codes eines alltäglichen Rassismus der ihn umgebenden Gesellschaft hat er seit geraumer Zeit verinnerlicht. So beginnt er mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln, sein Haar zu glätten, findet in diesen Bemühungen Unterstützung bei seiner Grossmutter, die ihn ab und zu hütet, derweil Marta ihn immer unverhohlener ablehnt. Denn je obsessiver Junior sich mit seinen Haaren beschäftigt, umso mehr scheint dies der Mutter ein Beweis für die beginnende Homosexualität des Sohnes – und diese «Schande» muss sie verhindern, um jeden Preis. Der dritte Langspielfilm der Venezolanerin Mariana Rondón (*1966) ist ein Plädoyer gegen Fanatismus und für Toleranz, gedreht in einem Land, das auf der Kinolandkarte fast ein weisser Fleck ist – und das heute, mehr noch als zur Drehzeit des Filmes Anfang 2013, als die «Bolivarianische Republik» mit dem herannahenden Tod ihres Begründers Hugo Chávez ihre Agonie erlebte, im Brennpunkt des Interesses liegt. Am letztjährigen Filmfestival San Sebastián gewann «Pelo malo» die Concha de Oro; es war das erste Mal in der Kinogeschichte, dass ein Film aus Venezuela den Hauptpreis eines A-Festivals erhielt. «Die ganze Tristesse des Alltagslebens in der Bolivarianischen Republik Venezuela fliesst beiläufig, unspektakulär und ohne darüber auch nur ein Wort zu verlieren in diesen grossen, ‹kleinen› Film ein, der aber in erster Linie von einer Frau handelt, die ihre Macht auszuspielen versucht in einer ungemein intoleranten und machistischen Gesellschaft.» Geri Krebs, NZZ
 Heute
Heute