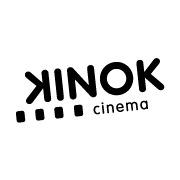Todd Haynes – Master of Queer Cinema
von Pamela Jahn
Manchmal genügt eine kleine braune Papierschachtel. Der ganze Skandal hinter der komplizierten Liebesgeschichte zwischen Gracie und ihrem Mann Joe verbirgt sich darin. Die Schauspielerin Elizabeth, die Gracie in einem Film verkörpern soll, hat sie vor deren Haus gefunden. Gracie öffnet sie mit einem routinierten Blick aus Abscheu und Gleichgültigkeit. Es sind Fäkalien, erklärt sie kühl, und es ist nicht das erste Paket dieser Art.
Diese Schachtel ist eine unverblümte Metapher für die Bosheit, die im Kern von Todd Haynes’ «May December» (2023) verborgen liegt – vor Jahren wurde Gracies Beziehung mit Joe in der Boulevard-Presse breitgetreten, nachdem sie beim Sex erwischt wurden, als er gerade einmal dreizehn Jahre alt war. Daraus entwickelt Haynes, der grosse Stilist und Meister des klassischen Melodrams, ein faszinierendes Verwirrspiel aus Wahrnehmung und Projektion, eine Dreiecksgeschichte, die durch gezielten Voyeurismus erschüttert wird, und einen Ego-Kampf zwischen zwei verblendeten Frauen, die vor der Kamera eine seltsame, faszinierende Symbiose vollziehen.
Lange macht sich Haynes einen grossen Spass daraus, mit unseren Erwartungen zu spielen, wohin sein jüngster Film führen wird. Der merkwürdige Zauber, der allen seinen Werken innewohnt, wirkt auch hier Wunder. Haynes’ unverdrossener Wille zur Dramatisierung, sein Gespür für Mise en Scène, für Perspektivwechsel, Kostüme und Musik und vor allem und immer wieder für filmische Gesten und Zitate, die er so klug und pointiert einzusetzen weiss, dass man seinen Augen kaum traut – all das macht jede neue Arbeit von ihm zu einem kleinen Ereignis, das es zu feiern gilt.
Unter den Kinorebell:innen der 1990er-Jahre, die den amerikanischen Independent-Film entrümpelten, galt der 1961 in Los Angeles geborene US-amerikanische Regisseur stets als der «intellektuelle Popautor des New Queer Cinema», der sich nie davor scheute, aus dem Kanon der Filmgeschichte zu zitieren, um daraus seine ureigene Kunstform zu entwickeln. Dabei haben es ihm längst nicht nur die 1950er-Jahre mit ihren eleganten Damengarderoben und satten Technicolorfarben angetan, die er so meisterlich in seiner grossen Douglas-Sirk-Hommage «Far from Heaven» (2002) und erneut in dem wunderbaren Liebesmelodram «Carol» (2015) rekonstruierte. In «Velvet Goldmine» (1998) war es die versunkene Ära des britischen Glamrock der frühen 1970er, für die sein Herz schlug.
Die Gewalten, die in den Filmen von Todd Haynes zusammenwirken, sind stets von künstlerischer und politischer Natur zugleich. Bereits in seinem von den Schriften Jean Genets inspirierten Spielfilmdebüt «Poison» (1991) führt er virtuos vor Augen, welche Mittel die Gesellschaft einsetzt, um sich Aussenseiter:innen vom Leib beziehungsweise ihr Anderssein im Zaum zu halten. Der Film gilt bis heute als einer der grossen Schätze des New Queer Cinema, ohne jedoch ein heterosexuelles Publikum auszuschliessen. Und auch ein aktueller Blick auf das im Film dargebotene Potpourri aus drei stilistisch wie historisch unterschiedlichen, ineinander verschachtelten Episoden über einen siebenjährigen Vatermörder, einen gescheiterten Wissenschaftler und einen Dieb, der im Gefängnis seine Liebe findet, lässt keine Zweifel offen: Haynes macht Filme, die betören und die polarisieren.
Auf der einen Seite zeigen sie Figuren, die ihren Weg gehen, aber das nicht ohne anzuecken an den herrschenden Strukturen und kollektiven Machtverhältnissen wie Rassismus, Sexismus und Homophobie. Und nicht selten drohen sie gar gänzlich zu scheitern an dem trügerischen Freiheits- und Glücksversprechen einer Welt, die für ihre Empfindungen keinen Platz hat. Ganz gleich wie unerschrocken, leidenschaftlich und gewieft sie sich auch gegen innere Zwänge und äussere Konventionen aufzubäumen versuchen, ihr Bewegungsspielraum ist reguliert, ihr Sturz zumeist vorprogrammiert.
Haynes, der studierte Semiotiker unter den Filmemacher:innen, hat selbst einmal behauptet, seine Filme würden immer irgendwie lügen. Wenn dem so ist, bestätigt «Carol» wohlweislich die Ausnahme der Regel. Es ist Haynes’ ehrlichster, sein gradlinigster Film und die leise Wucht, mit der er darin die Geschichte einer verbotenen Liebe zwischen zwei Frauen im New York der frühen 1950er-Jahre erzählt, zwischen der älteren, verheirateten Titelfigur und der jüngeren Therese, ist eine Ausnahmeerscheinung im gegenwärtigen Kino. Weniger eine Hommage als ein Augenzwinkern an David Lean und sein Meisterwerk «Brief Encounter» (1945) perfektioniert Haynes darin sein teuflisches Spiel mit schwindelerregenden Perspektivwechseln und filmischen Verbeugungen, die seine eigene innige Liebe zum Kino nicht nur offenbaren, sondern regelrecht in die Leinwand einbrennen.
Tatsächlich stand bereits seit dem internationalen Erfolg von «Far from Heaven» fest, dass der heute 63-Jährige durchaus auch die ganz grossen Gefühle stets im Griff hat, ohne jemals Gefahr zu laufen, in Sentimentalität oder gar Kitsch abzugleiten. Denn gelernt hatte Haynes im Kino selbst: Sirk, Hitchcock und Welles dienten ihm als stilbildende Inspirationsquellen, aber auch Fassbinder, mit dem ihn nicht nur ein Faible für Jean Genet, sondern mehr noch eine innige Passion für die klassischen Melodramen der 1940er- und 1950er-Jahre verband. Deshalb verwundert es wenig, dass sich beide ausgerechnet Douglas Sirks «All That Heaven Allows» (1955) als primäre Vorlage für ihre eigenen Variationen einer Auseinandersetzung mit dem mehr oder weniger offenen Rassismus der weissen Mittelschicht und den stickigen Konventionen ihrer Zeit nahmen. In Haynes’ Film spielt Julianne Moore die auf sie massgeschneiderte Rolle der liebesdurstigen Hausfrau, die, nachdem sie erfährt, dass ihr eigener Mann Männer bevorzugt, mit ihrem schwarzen Gärtner eine Romanze erlebt, die unweigerlich im Keim erstickt wird. Was bleibt, sind die Emotionen, die keine Ruhe finden, und die glühende Schwermut zweier Menschen, die sich für kurze Zeit in himmlische Höhen aufschwingen durften, bevor die Realität sie wieder einfing.
Anders sieht es aus, wenn Haynes Männerfiguren ins Zentrum des Geschehens rückt. Dabei scheint ihn im gleichen Atemzug eine ungeheure Lust am labyrinthischen Erzählen zu überkommen. Vor allem seine geniale Bob-Dylan-Biografie «I’m Not There» (2007) bestätigt sein unerhörtes Gespür für Genrefusionen, Farbspiele und Montagetechniken, anhand derer er ein einzigartiges Phantombild der Musiker-Ikone entwirft, die Dylan selbst nie sein wollte und der deshalb seine eigene Wandlungsfähigkeit zur Kunst machte. Gerade im permanenten Umschlag von den bisweilen steril anmutenden Schwarz-Weiss-Passagen zu stilistischen Ausflügen in die Nouvelle Vague und Westernpassagen, die an den Outlaw-Dylan in Sam Peckinpahs «Pat Garrett & Billy the Kid» (1973) erinnern, liegt die Faszination dieses Films.
Manchmal schweift Haynes auch gänzlich in die Wirklichkeit ab. Die Musiker:innen von «The Velvet Underground», die sich 1964 in New York formierten und nach fünf Jahren wieder trennten, waren stets mehr als eine Band. In seiner gleichnamigen Musikdokumentation nimmt der Regisseur sich des einzigartigen Phänomens und des ewigen Mythos rund um Frontmann Lou Reed, Gelegenheitssängerin Nico und den ersten «Band-Manager» Andy Warhol an. Aus tiefgreifendem Archivmaterial und zahlreichen Interviews mit Zeitgenoss:innen und Wegbegleiter:innen hat er ein bemerkenswertes Filmporträt geschaffen, das inspiriert, überrascht und nicht nur Liebhaber:innen der Musik unter die Haut geht.
Ob Dokumentation, Melodrama oder künstlerisches Experiment, das Wunderbare an Todd Haynes’ Filmen ist, dass er sich nie über seine Protagonist:innen stellt. Lieber fragt er gemeinsam mit ihnen, wie alles gekommen ist, warum es ist, wie es ist, und wie es weitergehen soll. Seine Werke sind Zeugnisse einer tiefen Zuneigung für die komplexen, aufgewühlten Welten, die er beobachtet, ganz gleich wie trivial oder surreal sie auf den ersten Blick scheinen mögen. Wie eine Papierschachtel eben, von der man, bevor man sie öffnet, nie weiss, was in ihr steckt.
Pamela Jahn ist freie Autorin und Journalistin. Sie schreibt u.a. für das ray Filmmagazin, FAQ und Filmbulletin. Sie lebt in London und ist dort auch als Übersetzerin und Filmkuratorin tätig.
 Heute
Heute